 |
 |
 |
 |
|
 lifedays-seite lifedays-seite
moment
in time
|
|
|
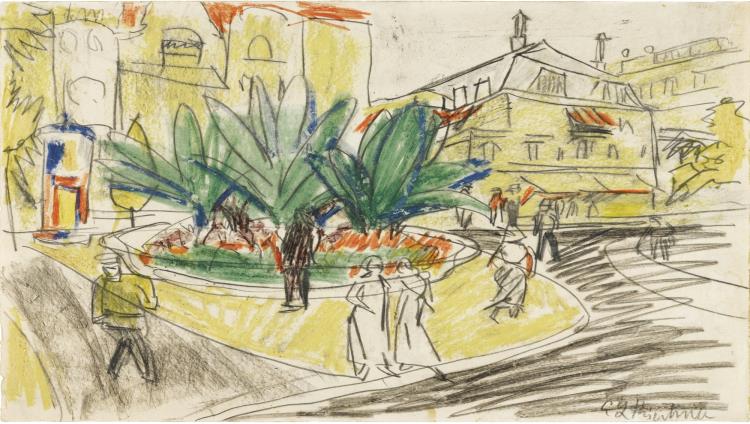
04.2
Literarische Epochen
Verzeichnis der literarischen Epochen
Exilliteratur

Exilliteratur
Als
Exilliteratur, auch Emigrantenliteratur, wird die Literatur von
Schriftstellern bezeichnet, die unfreiwillig Zuflucht in der Fremde
suchen müssen, weil ihre Person oder ihr Werk im Heimatland bedroht
ist. Meist geben politische oder religiöse Gründe den Ausschlag für die
Flucht ins Exil.
Der
Begriff „Exilliteratur“ ist der fachlich gebräuchlichere. Während
Emigration neutral den Wechsel des Wohnortes von einem Land in ein
anderes bezeichnet, bedeutet Exil eher das Land, welches Zufluchtsort
wird. Mitunter wird der Begriff auch für literarische Werke verwendet,
die als verbotene Literatur in Exilverlagen erscheinen müssen, auch
wenn deren Verfasser in ihrem Heimatland bleiben, also keine Emigranten
sind.
Deutsche
Exilliteratur
Die
deutsche Exilliteratur entstand 1933–1945 als Literatur der Gegner des
Nationalsozialismus. Dabei spielten die Bücherverbrennungen am 10. Mai
1933 und der deutsche Überfall auf die Nachbarstaaten 1938/39 eine
ausschlaggebende Rolle. Emigrantenzentren entstanden in Paris,
Amsterdam, Stockholm, Zürich, Prag, Moskau, New York und Mexiko, wo
unter meistens schwierigen Bedingungen Verlage gegründet wurden.
Bekannte Verlage für Exilliteratur waren z. B. in Amsterdam der Querido
Verlag und Allert de Lange Verlag und in Zürich der Europa Verlag des
Buchhändlers Emil Oprecht. Zu den bekanntesten Autorinnen und Autoren
im Exil zählten Bertolt Brecht, Hermann Broch, Ernst Bloch, Alfred
Döblin, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, A. M. Frey, Anna Gmeyner, Oskar
Maria Graf, Heinrich Eduard Jacob, Hermann Kesten, Annette Kolb,
Siegfried Kracauer, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas
Mann, Robert Neumann, Erich Maria Remarque, Ludwig Renn, Alice
Rühle-Gerstel, Otto Rühle, Alice Schwarz-Gardos, Anna Seghers, B.
Traven, Franz Werfel, Bodo Uhse, Arnold Zweig, Balder Olden und Rudolf
Olden. Germanisten wie John Spalek haben sich diesen Schriftstellern
gewidmet.
Die
Autoren Ernst Toller, Walter Hasenclever, Walter Benjamin, Kurt
Tucholsky, Stefan Zweig, und Ernst Weiß begingen Selbstmord im Exil.
In
Deutschland verblieben andererseits Schriftsteller, die sich in die
innere Emigration zurückzogen, wie Frank Thiess, Stefan Andres,
Gottfried Benn, Reinhold Schneider, Werner Bergengruen, Erich Kästner,
Ernst Kreuder, Gertrud von Le Fort, Ernst Wiechert und Ehm Welk.
Jüdische
Exilliteratur [Bearbeiten]
Eine
besondere Richtung bildet die jüdische Exilliteratur. Zu ihren
bekanntesten Vertreterinnen zählen beispielsweise Nelly Sachs
(Nobelpreis 1966) und Else Lasker-Schüler. Die jüdische Exilliteratur
spielt auch eine Rolle in jiddischsprachigen Zentren der USA. Als
bekanntester Vertreter gilt Isaac Bashevis Singer (Nobelpreis 1978).
Auch
die osteuropäische Exilliteratur ist infolge der Entwicklung im
ehemaligen Osteuropa reichhaltig.
Bundesrepublik und DDR
Die
Werke in die BRD übergesiedelter Autoren (z.B. Günter Kunert, Sarah
Kirsch, Jürgen Fuchs) aus der DDR als Exilliteratur zu bezeichnen, ist
umstritten. Diese Schriftsteller hatten im Westen oftmals weder
Publikations- noch Sprachprobleme, wechselten mithin scheinbar vom
kalten ins warme Wasser. Aber Wolf Biermann fasste seine Seelenlage als
exilierter DDR-Schriftsteller in die drastischen Worte: Vom Regen in
die Jauche.
Textgrundlage
 Wichtige
Exilautoren
Anna
Seghers
Kurt
Tucholsky
Walter
Hasenclever
Thomas
Mann
Wichtige
Exilautoren
Anna
Seghers
Kurt
Tucholsky
Walter
Hasenclever
Thomas
Mann


oben
__________________________________
Logo
381: "Das
Boskett auf dem Albertplatz in Dresden",
Ermt Ludwig Kirchner,
gemeinfrei
wikipedia
|
 lifedays-seite
- moment in time lifedays-seite
- moment in time  |
| |
|
 |
 |
 |
 |
|